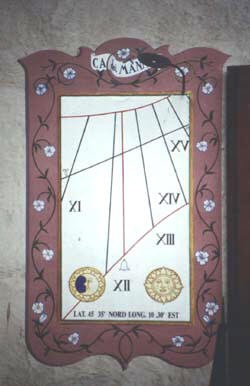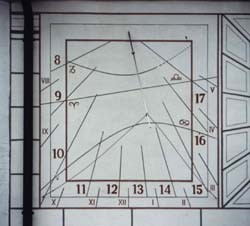Wo immer man ihnen begegnet, historische an
Schlössern, Stadttoren, Türmen und insbesondere an Kirchen, neuere auch an
anderen Gebäuden: es geht eine seltsam faszinierende Wirkung von ihnen aus.
Geheimnisvoll sehen sie aus, mitunter auch
unscheinbar, immer aber ein wenig fremd, meist jedoch schön:
Sonnenuhren
Häufig kaum wahrgenommen, zuweilen aber auch
bewundert, nicht selten kunstvolle Gebilde, manchmal nur noch Schmuck, vielfach
nicht mehr verstanden, deshalb auch rätselhaft.
Eine Sonnenuhr ist ein
"schönwetterbedingter", in der Regel ortsfester Zeitmesser, auf dem
mit dem Schatten eines von der Sonne beschienenen Schattenwerfers die Zeit
abgelesen werden kann. Sie ist das Produkt einer jahrtausendalten Entwicklung
über immer neues Beobachten, Experimentieren, Berechnen und die Erkenntnisse
daraus.
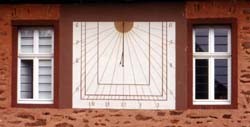 Während Sonnenuhren heute vornehmlich Schmuck
und Dekoration von Gebäuden darstellen, waren sie früher wichtige
Zeitanzeigen. Sie sind daher auch ein eindrucksvolles und bedeutendes Stück
Technikgeschichte, demonstrieren sie doch den Erfindergeist und die Klugheit
vergangener Generationen. Als Bestandteil des geschichtlichen Erbes geben sie
Einblick in die Lebensabläufe früherer Generationen und einstiger
Kulturepochen.
Während Sonnenuhren heute vornehmlich Schmuck
und Dekoration von Gebäuden darstellen, waren sie früher wichtige
Zeitanzeigen. Sie sind daher auch ein eindrucksvolles und bedeutendes Stück
Technikgeschichte, demonstrieren sie doch den Erfindergeist und die Klugheit
vergangener Generationen. Als Bestandteil des geschichtlichen Erbes geben sie
Einblick in die Lebensabläufe früherer Generationen und einstiger
Kulturepochen.
Oberhunden
Historische Sonnenuhren sind Spuren der
Vergangenheit, sie zeigen in vielen Fällen mit ihren teilweise noch originalen
Werkspuren die handwerklich-technischen Fertigkeiten und die z. T. hohen
künstlerischen Fähigkeiten der Erbauer sowie insbesondere deren mathematisches
und astronomisches Können.
Die gelegentlich zu vernehmende Behauptung,
Sonnenuhren gingen falsch, ist so nicht zutreffend. Sie gehen anders, und dies
ist in der historischen Entwicklung der Zeitmessung begründet.

Sonnenuhren gab es bereits in Ägypten und
Griechenland ab etwa 1500 v. Chr. Dabei diente in der Regel ein Obelisk o. ä.
als Schattenwerfer. Es folgten die verschiedensten Formen wie die
Hohlkugelsonnenuhren in der Antike, danach vom 7. Jh. bis ins späte Mittelalter
die vertikalen, meist halbkreisförmigen und in mehrere Sektoren eingeteilten
Sonnenuhren mit dem im Kreismittelpunkt waagerecht vor der Uhrenfläche
stehenden Stab an den Mauern von Kirchen und Klöstern. Durch den Schattenschlag
auf der Skala war eine Tageseinteilung möglich, das Prinzip aller Sonnenuhren.
Gelnhausen
 Aus dem Orient kam zu Beginn des 15. Jh. der
erdachsparallele Schattenstab (Polstab), der im 18. Jh. die Sonnenuhr in Europa
zu einer außergewöhnlichen Vollkommenheit gebracht hat, war es doch damit
möglich, neben den genauen Stunden auch noch andere Daten von einer Sonnenuhr
abzulesen. In der Barockzeit kamen künstlerische Formen zur Ausführung, die
eine Sonnenuhr mehr und mehr auch zu einem Kunst- und Schmuckstück werden
ließen, wo neben den Stunden vielfach auch das Sternzeichen, die Tagesdauer,
den Sonnenauf- und Untergang und manches andere angezeigt werden konnte.
Aus dem Orient kam zu Beginn des 15. Jh. der
erdachsparallele Schattenstab (Polstab), der im 18. Jh. die Sonnenuhr in Europa
zu einer außergewöhnlichen Vollkommenheit gebracht hat, war es doch damit
möglich, neben den genauen Stunden auch noch andere Daten von einer Sonnenuhr
abzulesen. In der Barockzeit kamen künstlerische Formen zur Ausführung, die
eine Sonnenuhr mehr und mehr auch zu einem Kunst- und Schmuckstück werden
ließen, wo neben den Stunden vielfach auch das Sternzeichen, die Tagesdauer,
den Sonnenauf- und Untergang und manches andere angezeigt werden konnte.
Klagenfurt
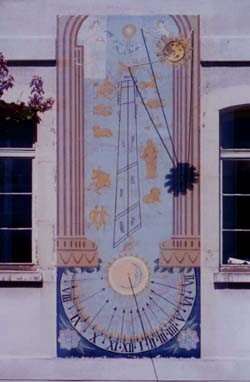 Auch als im späten Mittelalter die Räderuhren
erfunden wurden, erfüllte die Sonnenuhr noch einen wichtigen Zweck: Sie war
unentbehrlich zur Überprüfung der Genauigkeit. Erst mit zunehmender Präzision
der mechanischen Uhren hatte sie ihre eigentliche Funktion eingebüßt, erst
recht nach Einführung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), da ohne die genaue
Kenntnis der Systematik des Ablesens und der Umrechnung das Erkennen einer
"gültigen" Uhrzeit jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich war. Die
"richtige" Zeitablesung von einer Sonnenuhr erforderte neben der
visuellen Wahrnehmung auch geistige Arbeit und die Kenntnisse des Standortes und
den tagesaktuellen Wert der sog. Zeitgleichung.
Auch als im späten Mittelalter die Räderuhren
erfunden wurden, erfüllte die Sonnenuhr noch einen wichtigen Zweck: Sie war
unentbehrlich zur Überprüfung der Genauigkeit. Erst mit zunehmender Präzision
der mechanischen Uhren hatte sie ihre eigentliche Funktion eingebüßt, erst
recht nach Einführung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), da ohne die genaue
Kenntnis der Systematik des Ablesens und der Umrechnung das Erkennen einer
"gültigen" Uhrzeit jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich war. Die
"richtige" Zeitablesung von einer Sonnenuhr erforderte neben der
visuellen Wahrnehmung auch geistige Arbeit und die Kenntnisse des Standortes und
den tagesaktuellen Wert der sog. Zeitgleichung.
Straßburg
Die alten Sonnenuhren waren nach dem Zeitsystem
der Ortszeit konstruiert, was bedeutet, dass um 12:00 Uhr die Sonne am
jeweiligen Standort genau im Süden steht. Daher hatten Orte, die auf
unterschiedlichen Längengraden liegen, auch unterschiedliche Zeiten.
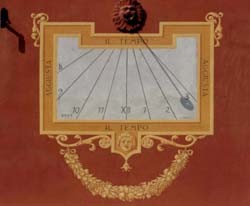
Diese (südlichen) Ortszeit-Sonnenuhren sind u.
a. daran zu erkennen, dass die Zwölf-Uhr-Mittagslinie (Meridianlinie) senkrecht
unter dem Fußpunkt des Schattenstabes steht. Solche Sonnenuhren zeigen den
augenblicklichen sowie den zurück- und vorausliegenden Sonnenstand an.
Lazise
Es gibt sie nicht, die Sonnenuhr, vielmehr
existieren Sonnenuhren in einer Vielzahl unterschiedlichster Ausführungen, wo
z. B. Gebetszeiten, die "temporalen" Stunden, die Zeitstunden, die
Wahre Ortszeit (WOZ), die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), die Mitteleuropäische
Sommerzeit (MESZ), das Datum, die Tierkreise, die Sonnenwenden, die
Tagundnachtgleichen und, je nach Konstruktion, der jahreszeitbedingte
Zeitausgleich, der Zeitpunkt von Sonnenauf- und Untergang, die Stunden bis zum
Sonnenauf- und Untergang, die Tag- und Nachlängen und noch so manches andere
abgelesen werden kann.
Auch die Möglichkeiten der Ausführung sind
vielfältig, z. B.:
äquatoriale Sonnenuhren mit äquatorparallelem
Zifferblatt,
horizontale Sonnenuhren auf einem Podest oder auf dem Boden,
vertikale Sonnenuhren auf senkrechten Flächen wie Wände o. ä.,
Ecksonnenuhren mit zwei z. B. an einer Mauerecke angeordneten Zifferblättern,
Vielflächner als Kugel, Würfel oder andere Körper mit Zifferblättern an
den verschiedenen Flächen sowie
Ringsonnenuhren, Zylindersonnenuhren, Hohlkugelsonnenuhren usw.
Die Ausführung des Schattenwerfers kann
ebenfalls vielgestaltig sein, als Stab, als Kante, als Lichtpunkt einer
Lochscheibe usw. Neben dem senkrechten Schattenstab auf waagerechten Flächen,
der als Gnomon bezeichnet wird, und dem horizontalen Schattenstab an senkrechten
Flächen ist es vor allem der parallel zur Erdachse ausgerichtete
"Polstab" südlicher Sonnenuhren, der durch seinen Schattenschlag die
Zeit und oftmals noch vieles andere mehr auf der Uhrenfläche anzeigt.
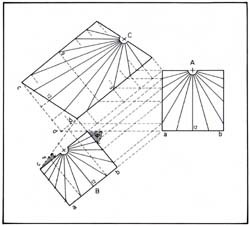 Zur Einrichtung oder zur Reparatur einer
Sonnenuhr und damit zur Anordnung oder zur Kontrolle der unterschiedlichen
Abstände der Stunden-, Datums- und sonstigen Linien sind mehr oder weniger
komplizierte zeichnerische Ausarbeitungen oder mathematische Berechnungen
erforderlich (was jedoch auch durch das Festhalten der tatsächlichen
Schattenwürfe zu bewerkstelligen ist).
Zur Einrichtung oder zur Reparatur einer
Sonnenuhr und damit zur Anordnung oder zur Kontrolle der unterschiedlichen
Abstände der Stunden-, Datums- und sonstigen Linien sind mehr oder weniger
komplizierte zeichnerische Ausarbeitungen oder mathematische Berechnungen
erforderlich (was jedoch auch durch das Festhalten der tatsächlichen
Schattenwürfe zu bewerkstelligen ist).
Nur auf einer genau nach Süden gerichteten Wand
zeigt eine Sonnenuhr z. B. die 12 Sonnenstunden eines Tages zur Zeit der
Tagundnachtgleiche. Auf östlich gerichteten Wänden zeigt eine Sonnenuhr mehr
Vormittagstunden, auf westlich gerichteten Wänden mehr Nachmittagstunden an.
Diese nach Südosten gerichtete Sonnenuhr enthält deshalb mehr Vormittags- als
Nachmittagstunden.
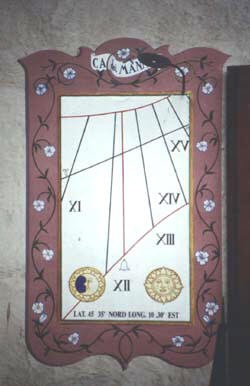
Viele Sonnenuhrzifferblätter enthalten unter dem
Stabeinsatzpunkt eine senkrechte Mittagslinie. Sie wird bestimmt durch den
Mittagschatten: Es ist örtlicher Wahrer Mittag, wenn die Sonne ihren
Höchststand überschreitet, d.h., wenn sie genau im Süden steht. Es ist 12:00
Uhr Wahre Ortszeit (WOZ), wenn der Schatten des Schattenstabes die senkrechte
Mittagslinie überdeckt.
Seit 1893 gilt in Deutschland als konventionelle
Normalzeit die Mitteleuropäische Zeit (MEZ). Das ist die Mittlere Ortszeit
(MOZ) auf dem 15. östlichen Längengrad. Wenn dort die Sonne am höchsten und
damit der Zeigerschatten genau senkrecht steht, ist es 12:00 Uhr
Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Gargnano
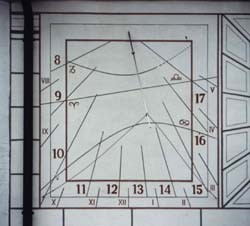
Die Ortszeit in der Mitte Deutschlands, z. B. am
15. Längengrad Ost, geht gegenüber der Mitteleuropäischen Zeit ca. 24 Minuten
nach. Deshalb ist zum Ausgleich an die Normalzeit das Zifferblatt einer sog.
Zonenzeit-Sonnenuhr gegenüber der Wahren Ortszeit um die entsprechende Zeit
nach links (in den Vormittag) verschoben.
Ulm
Da die Erde die Sonne auf einer elliptischen Bahn
und mit geringfügig veränderter Geschwindigkeit umkreist, stimmen Sonnenzeit
und Normalzeit im Jahresverlauf nur 4x überein: am 15./16. April, 15./16. Juni,
30./31. August und 1. September sowie am 25./26. Dezember. Im Frühling und im
Sommer betragen die Unterschiede zur Normalzeit von –4 Minuten im Mai bis +6
Minuten im Juli/August, im Herbst und Winter von –16 Minuten im
Oktober/November bis +15 Minuten im Februar. Beim Ablesen des Schattenschlages
auf den Stundenlinien sind diese Unterschiede von der angezeigten Zeit je nach
Vorzeichen abzuziehen bzw. hinzuzurechnen. Erst damit ergibt sich bei der
Ablesung der Sonnenuhr die Mitteleuropäische Zeit/Mitteleuropäische
Sommerzeit.
|
Zeitausgleich in
Minuten:
Die Plus-Werte sind der abgelesenen Zeit auf der
Sonnenuhr hinzuzurechnen,
die Minus-Werte von der abgelesenen Zeit abzuziehen:
|
|
Am: |
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Mai |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dez |
|
01. |
+ 3 |
+ 14 |
+ 13 |
+ 4 |
- 3 |
- 2 |
+ 4 |
+ 6 |
0 |
- 10 |
- 16 |
- 11 |
|
10. |
+ 7 |
+ 14 |
+ 11 |
+ 2 |
- 4 |
- 1 |
+ 5 |
+ 5 |
- 3 |
- 13 |
- 16 |
- 8 |
|
20. |
+ 11 |
+ 14 |
+ 8 |
- 1 |
- 4 |
+ 1 |
+ 6 |
+ 4 |
- 6 |
- 15 |
- 15 |
- 3 |
Zurück
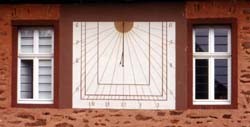 Während Sonnenuhren heute vornehmlich Schmuck
und Dekoration von Gebäuden darstellen, waren sie früher wichtige
Zeitanzeigen. Sie sind daher auch ein eindrucksvolles und bedeutendes Stück
Technikgeschichte, demonstrieren sie doch den Erfindergeist und die Klugheit
vergangener Generationen. Als Bestandteil des geschichtlichen Erbes geben sie
Einblick in die Lebensabläufe früherer Generationen und einstiger
Kulturepochen.
Während Sonnenuhren heute vornehmlich Schmuck
und Dekoration von Gebäuden darstellen, waren sie früher wichtige
Zeitanzeigen. Sie sind daher auch ein eindrucksvolles und bedeutendes Stück
Technikgeschichte, demonstrieren sie doch den Erfindergeist und die Klugheit
vergangener Generationen. Als Bestandteil des geschichtlichen Erbes geben sie
Einblick in die Lebensabläufe früherer Generationen und einstiger
Kulturepochen.
 Aus dem Orient kam zu Beginn des 15. Jh. der
erdachsparallele Schattenstab (Polstab), der im 18. Jh. die Sonnenuhr in Europa
zu einer außergewöhnlichen Vollkommenheit gebracht hat, war es doch damit
möglich, neben den genauen Stunden auch noch andere Daten von einer Sonnenuhr
abzulesen. In der Barockzeit kamen künstlerische Formen zur Ausführung, die
eine Sonnenuhr mehr und mehr auch zu einem Kunst- und Schmuckstück werden
ließen, wo neben den Stunden vielfach auch das Sternzeichen, die Tagesdauer,
den Sonnenauf- und Untergang und manches andere angezeigt werden konnte.
Aus dem Orient kam zu Beginn des 15. Jh. der
erdachsparallele Schattenstab (Polstab), der im 18. Jh. die Sonnenuhr in Europa
zu einer außergewöhnlichen Vollkommenheit gebracht hat, war es doch damit
möglich, neben den genauen Stunden auch noch andere Daten von einer Sonnenuhr
abzulesen. In der Barockzeit kamen künstlerische Formen zur Ausführung, die
eine Sonnenuhr mehr und mehr auch zu einem Kunst- und Schmuckstück werden
ließen, wo neben den Stunden vielfach auch das Sternzeichen, die Tagesdauer,
den Sonnenauf- und Untergang und manches andere angezeigt werden konnte.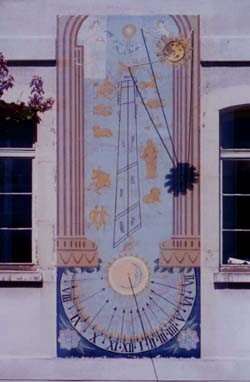 Auch als im späten Mittelalter die Räderuhren
erfunden wurden, erfüllte die Sonnenuhr noch einen wichtigen Zweck: Sie war
unentbehrlich zur Überprüfung der Genauigkeit. Erst mit zunehmender Präzision
der mechanischen Uhren hatte sie ihre eigentliche Funktion eingebüßt, erst
recht nach Einführung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), da ohne die genaue
Kenntnis der Systematik des Ablesens und der Umrechnung das Erkennen einer
"gültigen" Uhrzeit jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich war. Die
"richtige" Zeitablesung von einer Sonnenuhr erforderte neben der
visuellen Wahrnehmung auch geistige Arbeit und die Kenntnisse des Standortes und
den tagesaktuellen Wert der sog. Zeitgleichung.
Auch als im späten Mittelalter die Räderuhren
erfunden wurden, erfüllte die Sonnenuhr noch einen wichtigen Zweck: Sie war
unentbehrlich zur Überprüfung der Genauigkeit. Erst mit zunehmender Präzision
der mechanischen Uhren hatte sie ihre eigentliche Funktion eingebüßt, erst
recht nach Einführung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ), da ohne die genaue
Kenntnis der Systematik des Ablesens und der Umrechnung das Erkennen einer
"gültigen" Uhrzeit jetzt nicht mehr ohne weiteres möglich war. Die
"richtige" Zeitablesung von einer Sonnenuhr erforderte neben der
visuellen Wahrnehmung auch geistige Arbeit und die Kenntnisse des Standortes und
den tagesaktuellen Wert der sog. Zeitgleichung.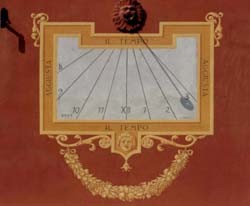
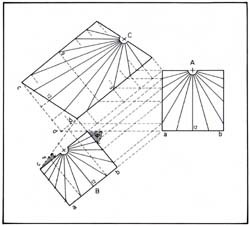 Zur Einrichtung oder zur Reparatur einer
Sonnenuhr und damit zur Anordnung oder zur Kontrolle der unterschiedlichen
Abstände der Stunden-, Datums- und sonstigen Linien sind mehr oder weniger
komplizierte zeichnerische Ausarbeitungen oder mathematische Berechnungen
erforderlich (was jedoch auch durch das Festhalten der tatsächlichen
Schattenwürfe zu bewerkstelligen ist).
Zur Einrichtung oder zur Reparatur einer
Sonnenuhr und damit zur Anordnung oder zur Kontrolle der unterschiedlichen
Abstände der Stunden-, Datums- und sonstigen Linien sind mehr oder weniger
komplizierte zeichnerische Ausarbeitungen oder mathematische Berechnungen
erforderlich (was jedoch auch durch das Festhalten der tatsächlichen
Schattenwürfe zu bewerkstelligen ist).